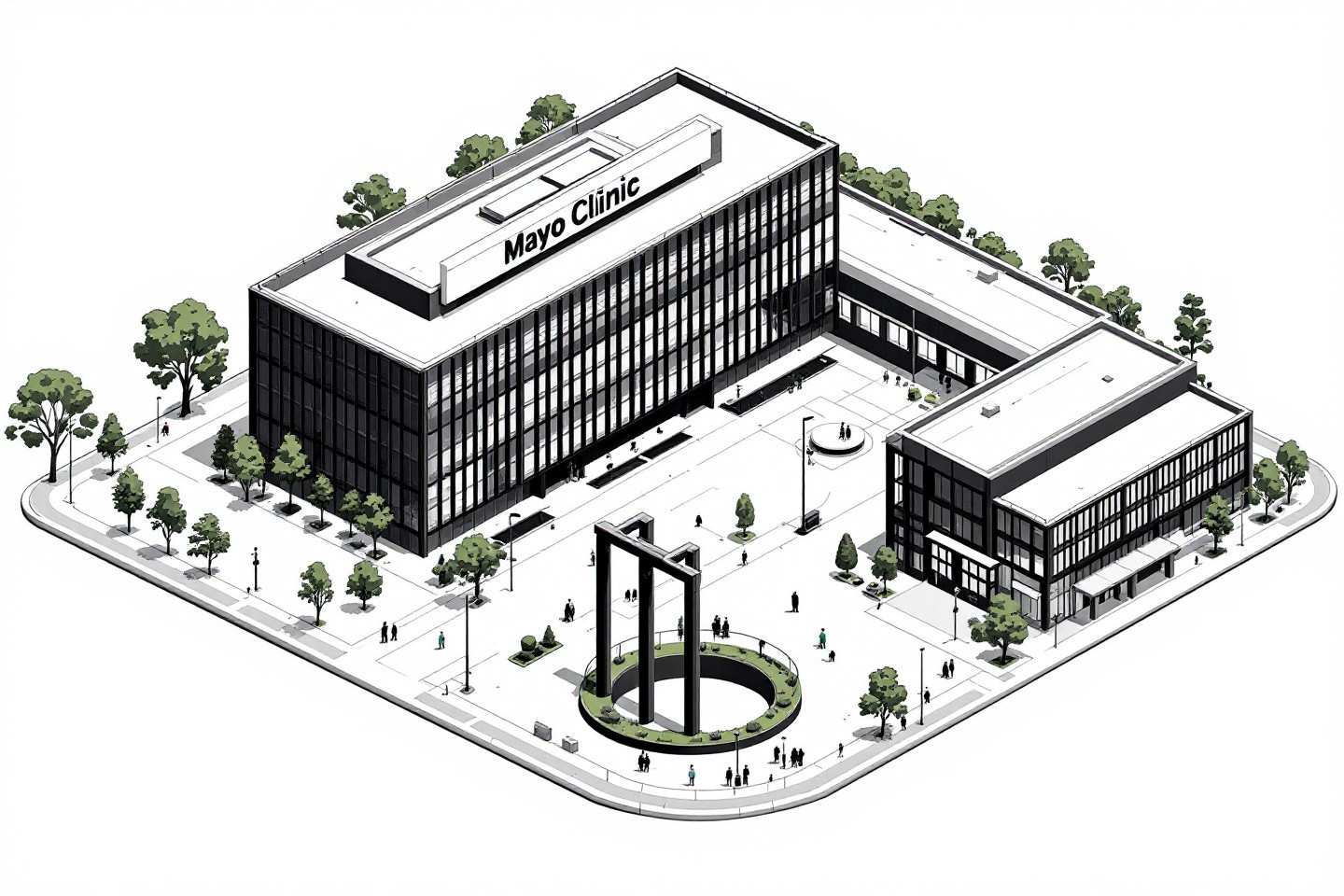Praxis
Praxisübernahme leicht gemacht: 10 Schritte zum erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit als Ärztin oder Arzt
Lesedauer: 14 Minuten
28.02.2025
Darum geht's
Der Schritt in die Selbstständigkeit ist einer der bedeutendsten in deiner ärztlichen Karriere – und die Übernahme einer bestehenden Praxis bringt dabei ganz eigene Chancen und Herausforderungen mit sich. Du stehst vor Entscheidungen, die deine berufliche Zukunft für Jahre prägen werden: von der Bewertung des Patientenstamms über Finanzierungsfragen bis hin zur Integration des bestehenden Teams.
Die Praxisübernahme ist mehr als nur ein wirtschaftlicher Vorgang. Sie bedeutet, ein funktionierendes System zu übernehmen und gleichzeitig deinen eigenen Stempel aufzudrücken – ohne bewährte Strukturen zu zerstören. Diese Balance zu finden, gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben beim Start in die Niederlassung.
In den folgenden 10 Schritten begleite ich dich durch den gesamten Prozess der Praxisübernahme. Vom ersten Gedanken über die Finanzierung bis hin zur langfristigen Erfolgssicherung erhältst du konkrete Handlungsempfehlungen und praxisnahe Tipps. Eine gründliche Vorbereitung minimiert nicht nur Risiken, sondern schafft dir auch den nötigen Freiraum, um von Anfang an als Ärztin oder Arzt zu überzeugen – und nicht nur als Krisenmanager.
Die verschiedenen Praxisformen im Vergleich
Die Entscheidung für die richtige Praxisform ist eine grundlegende Weichenstellung für deine berufliche Zukunft. Jedes Modell – Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft oder Medizinisches Versorgungszentrum – bietet spezifische Vor- und Nachteile, die du sorgfältig abwägen solltest.
Übernahme einer Einzelpraxis
Die klassische Einzelpraxis stellt nach wie vor den traditionellen Weg in die Selbstständigkeit dar. Als alleiniger Inhaber genießt du maximale Entscheidungsfreiheit – von der Gestaltung der Räumlichkeiten über die Personalauswahl bis hin zur Ausrichtung des Leistungsspektrums. Diese Unabhängigkeit ist für viele Ärzte der ausschlaggebende Faktor, sich für die Einzelpraxis zu entscheiden.
Bei der Übernahme einer Einzelpraxis trägst du allerdings auch das unternehmerische Risiko allein. Die Finanzierung muss vollständig durch dich gestemmt werden, ebenso wie alle betriebswirtschaftlichen Entscheidungen. Die Work-Life-Balance kann in den ersten Jahren durchaus leiden, da Vertretungen organisatorisch und finanziell herausfordernd sind.
Besonders wichtig ist bei der Einzelpraxis die sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Prüfe die Entwicklung der Fallzahlen über mehrere Jahre und hinterfrage kritisch, ob der bisherige Erfolg der Praxis maßgeblich an der Person des Vorgängers hing. Manche Einzelpraxen florieren aufgrund der besonderen Persönlichkeit oder Reputation des scheidenden Arztes – ein Faktor, den du nicht einfach übernehmen kannst.
Einstieg in eine BAG/ÜBAG
Die Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft (ÜBAG) bietet einen sanfteren Einstieg in die Selbstständigkeit. Häufig beginnt der Weg hier mit einem gestaffelten Einstieg – zunächst als angestellter Arzt mit Option auf Partnerschaft, dann als Juniorpartner mit reduziertem Kaufpreis für die Anteile und schließlich als vollwertiger Partner.
Die wirtschaftlichen Vorteile einer BAG sind beträchtlich. Die Ressourcennutzung – von Geräten über Personal bis hin zur gemeinsamen Verwaltung – ist deutlich effizienter. Auch die Vertretung bei Urlaub, Krankheit oder Fortbildungen lässt sich unkomplizierter organisieren. Nicht zu unterschätzen ist zudem der fachliche Austausch mit den Kollegen, der sowohl die Qualität der Behandlung verbessern als auch die persönliche Zufriedenheit steigern kann.
Allerdings erfordert eine Gemeinschaftspraxis stets Kompromissbereitschaft. Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden, was manchmal langwierige Diskussionen bedeuten kann. Die Chemie zwischen den Partnern muss stimmen – persönlich wie fachlich. Deshalb ist es ratsam, vor dem Einstieg eine ausgedehnte Probephase als Angestellter zu vereinbaren. Prüfe auch die bestehenden Verträge sorgfältig; besonders wichtig sind klare Regelungen für einen möglichen späteren Ausstieg aus der Gemeinschaft.
Einstieg in ein MVZ
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) stellt eine vergleichsweise junge Praxisform dar, die jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnt. MVZs werden von unterschiedlichen Trägern betrieben – von Krankenhäusern über Kommunen bis hin zu Ärztegenossenschaften. Als Arzt im MVZ bist du in der Regel angestellt, kannst aber je nach Struktur des Zentrums auch Gesellschafteranteile erwerben.
Der große Vorteil eines MVZ liegt in der umfassenden Infrastruktur. Die gesamte Verwaltung – von der Abrechnung über das Personalwesen bis hin zum Qualitätsmanagement – wird zentral organisiert. Das ermöglicht dir, dich nahezu vollständig auf die medizinische Tätigkeit zu konzentrieren. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Fachrichtungen unter einem Dach erleichtert die Patientenversorgung erheblich.
Die Anstellung im MVZ bietet zudem ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und Planbarkeit. Ein festes Gehalt, geregelte Arbeitszeiten und gesicherte Urlaubsansprüche sorgen für eine ausgewogene Work-Life-Balance, die in der klassischen Niederlassung oft schwerer zu erreichen ist.
Demgegenüber steht der Verlust an unternehmerischer Freiheit. Die Entscheidungskompetenzen sind in einem MVZ deutlich eingeschränkter als in einer eigenen Praxis. Strategische Entscheidungen werden von der Geschäftsführung getroffen, medizinische Leitlinien oft zentral vorgegeben. Auch die Arbeitszeiten und -bedingungen sind weniger flexibel gestaltbar. Zudem besteht in manchen MVZs ein höherer Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsdruck als in individuell geführten Praxen.
Entscheidungsfindung
Bei der Wahl der passenden Praxisform solltest du neben den wirtschaftlichen Aspekten unbedingt auch deine persönlichen Präferenzen berücksichtigen. Bist du ein Teamplayer oder arbeitest du lieber eigenverantwortlich? Wie wichtig ist dir unternehmerische Freiheit im Vergleich zu planbaren Arbeitszeiten? Welche Rolle spielt das finanzielle Risiko in deiner Lebensplanung?
Eine gute Orientierungshilfe bieten Hospitationen in unterschiedlichen Praxisformen. Sprich mit Kollegen, die den Schritt bereits gewagt haben, und lass dich von einem erfahrenen Praxisberater begleiten, der die regionalen Besonderheiten deines Niederlassungsgebiets kennt.
Bedenke auch die langfristige Perspektive: Die gewählte Praxisform sollte nicht nur zu deiner aktuellen Lebenssituation passen, sondern auch Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft bieten. Während eine Einzelpraxis später oft schwer verkäuflich ist, bieten Gemeinschaftspraxen und MVZs meist flexiblere Exit-Strategien.
Die richtige Praxis finden

Standortanalyse und Patientenpotenzial
Die Wahl des richtigen Standorts ist entscheidend für deinen langfristigen Erfolg. Analysiere das Einzugsgebiet gründlich: Wie gut ist die Verkehrsanbindung? Gibt es ausreichend Parkplätze? Ist die Praxis auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? Ein bequemer Zugang kann den Unterschied zwischen wachsendem und stagnierendem Patientenstamm ausmachen.
Betrachte die demografische Struktur der Region. Eine Kinderarztpraxis in einem Viertel mit überwiegend Senioren wäre beispielsweise wenig erfolgversprechend. Prüfe Bevölkerungsprognosen – wächst die Gemeinde oder ist mit Abwanderung zu rechnen? Das Statistische Bundesamt oder lokale Wirtschaftsförderungen bieten hierzu wertvolle Daten.
Verstehe die Wettbewerbssituation: Wie viele Kollegen deiner Fachrichtung praktizieren bereits vor Ort? Ein gesunder Wettbewerb ist normal, aber eine Überversorgung kann problematisch werden.
Bewertungskriterien für eine Praxis
Der Patientenstamm ist das Herzstück jeder Praxis. Prüfe nicht nur die reine Anzahl, sondern auch die Patientenbindung. Wie lange bleiben Patienten durchschnittlich? Eine hohe Fluktuation könnte auf Unzufriedenheit hindeuten. Die Altersstruktur des Patientenstamms gibt Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.
Beurteile die technische Ausstattung kritisch – moderne Geräte sind ein Plus, veraltete Technik bedeutet Investitionsbedarf. Achte auf Wartungsverträge und den allgemeinen Zustand der Medizintechnik.
Bei den Räumlichkeiten zählen nicht nur Größe und Zustand, sondern auch der Mietvertrag. Wie lange läuft er noch? Sind Preisanpassungen zu erwarten? Gibt es Erweiterungsmöglichkeiten? Barrierefreiheit ist heutzutage fast unerlässlich.
Betrachte schließlich die Wachstumsperspektiven. Gibt es Möglichkeiten, das Leistungsspektrum zu erweitern oder mehr Personal einzustellen? Eine Praxis, die bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, bietet weniger Entwicklungspotenzial als eine, die noch Luft nach oben hat.
Mehr zum Thema Praxisbewertung findest du in diesem Blogartikel.
Praxisfinanzierung sichern
Die richtige Kalkulation
Der Kaufpreis einer Praxis setzt sich aus materiellen und immateriellen Werten zusammen. Während Geräte, Einrichtung und Verbrauchsmaterialien relativ einfach zu bewerten sind, stellt der ideelle Wert – der sogenannte Goodwill – oft die größere Herausforderung dar. Dieser bemisst sich hauptsächlich am Patientenstamm und den zu erwartenden Einnahmen. Eine gängige Faustregel ist, dass der Goodwill etwa dem 0,5- bis 1,5-fachen des durchschnittlichen Jahresumsatzes entspricht. Lass den Kaufpreis unbedingt von einem auf Praxisbewertung spezialisierten Experten überprüfen.
Über den Kaufpreis hinaus musst du weitere Investitionen einkalkulieren. Technische Geräte könnten modernisierungsbedürftig sein, EDV-Systeme veraltet oder die Praxisräume renovierungsbedürftig. Diese Kosten können schnell 20.000 bis 50.000 Euro oder mehr betragen – ein Posten, den viele Praxisübernehmer unterschätzen.
Die laufenden Kosten bestimmen langfristig deinen wirtschaftlichen Erfolg. Kalkuliere Personalkosten, Miete, Versicherungen, Abschreibungen, Material und Laborkosten sorgfältig. Berücksichtige, dass in den ersten Monaten die Einnahmen geringer ausfallen könnten, während du dich einarbeitest und Patienten an deinen Behandlungsstil gewöhnst.
Finanzierungsmodelle und Fördermöglichkeiten
Banken haben für Ärzte häufig spezielle Konditionen, da sie als besonders kreditwürdige Berufsgruppe gelten. Dennoch solltest du Angebote von mehreren Banken einholen. Achte dabei nicht nur auf den Zinssatz, sondern auch auf Laufzeit, Tilgungsraten und Sondertilgungsmöglichkeiten. Eine maßgeschneiderte Finanzierung passt sich idealerweise deiner erwarteten Einkommensentwicklung an – mit anfänglich niedrigeren Raten, die mit steigendem Praxisumsatz anwachsen können.
Die KfW-Bank bietet mit dem ERP-Gründerkredit und dem Unternehmerkredit attraktive Förderprogramme mit günstigen Zinsen und tilgungsfreien Anlaufzeiten. Diese Mittel kannst du über deine Hausbank beantragen, die als Vermittler fungiert. In manchen Bundesländern gibt es zusätzliche Förderprogramme speziell für Ärzte.
In als unterversorgt eingestuften Gebieten winken Zuschüsse der Kassenärztlichen Vereinigungen. Diese können bis zu 60.000 Euro betragen und müssen nicht zurückgezahlt werden. Informiere dich frühzeitig bei der zuständigen KV über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
Steuerlich bietet die Praxisübernahme verschiedene Vorteile: Der Kaufpreis kann größtenteils über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Ein Steuerberater mit Erfahrung im Gesundheitswesen kann dir helfen, alle steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten optimal zu nutzen und einen strukturierten Finanzplan für die ersten Jahre zu erstellen.
Rechtliche Aspekte klären

Der Praxisübernahmevertrag
Der Praxisübernahmevertrag ist das Herzstück des gesamten Übernahmeprozesses. Er regelt nicht nur den Kaufpreis und dessen Fälligkeit, sondern auch, was genau du übernimmst. Zu den wesentlichen Bestandteilen gehören die detaillierte Auflistung aller materiellen Vermögensgegenstände (Inventar, Geräte, Verbrauchsmaterialien) sowie der immateriellen Werte (Patientenstamm, Praxisname, Telefonnummer, Internetauftritt). Auch Regelungen zur Übernahme von Personal und laufenden Verträgen (Leasing, Wartung, etc.) müssen präzise festgehalten werden.
Typische Fallstricke lauern oft im Kleingedruckten. Praxisübergeber versuchen manchmal, Gewährleistungsansprüche auszuschließen oder Patientenzahlen zu beschönigen. Achte auf klare Formulierungen bezüglich Wettbewerbsverboten – der Vorgänger sollte sich verpflichten, nicht in unmittelbarer Nähe eine neue Praxis zu eröffnen. Auch die Übergabe von Patientenakten und die Handhabung der Schweigepflichtentbindung müssen datenschutzkonform geregelt sein. Ein weiterer kritischer Punkt: die Regelung von Altverbindlichkeiten und laufenden Rechtsstreitigkeiten.
Eine umsichtige Planung mindert deine finanziellen Risiken. Denke hier an den Abschluss geeigneter Versicherungen, die laufende Kosten beispielsweise bei Betriebsunterbrechungen abdeckt.
Zulassungsverfahren und KV-Sitz
Der Ablauf des Zulassungsverfahrens folgt strengen Fristen und Regularien. Bei der Übernahme eines Vertragsarztsitzes musst du einen Antrag beim Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung stellen. Dieser Antrag sollte etwa drei bis vier Monate vor der geplanten Übernahme eingereicht werden. Die Entscheidung über die Zulassung erfolgt in einer Sitzung des Zulassungsausschusses, zu der du persönlich eingeladen wirst.
Bei Nachbesetzungsverfahren in gesperrten Planungsbereichen gelten besondere Regeln. Der abgebende Arzt muss zunächst beim Zulassungsausschuss die Ausschreibung seines Sitzes beantragen. Nach der Ausschreibung können sich alle interessierten Ärzte bewerben.
Der Zulassungsausschuss erstellt dann eine Rangliste nach gesetzlich festgelegten Kriterien wie Berufserfahrung, familiäre Bindungen zum Planungsbereich oder besondere Versorgungsaspekte. Der abgebende Arzt hat jedoch ein Vorschlagsrecht, das in der Regel berücksichtigt wird. Wichtig: Seit 2019 kann der Zulassungsausschuss in überversorgten Gebieten entscheiden, den Sitz nicht nachzubesetzen und stattdessen gegen Entschädigung einzuziehen.
Praxisstrukturen bewerten und anpassen
Die übernommene Praxis funktioniert bereits – doch wie gut? Eine gründliche Analyse der bestehenden Strukturen ist der Schlüssel zu einem reibungslosen Übergang und legt den Grundstein für zukünftige Verbesserungen.
Beginne mit einer umfassenden Bewertung der Praxisorganisation. Wie ist die Terminvergabe geregelt? Welche Abläufe bestehen für Notfälle? Wie werden Befunde dokumentiert? Beobachte den Praxisalltag idealerweise schon vor der Übernahme für einige Tage. Häufig haben sich über Jahre Routinen entwickelt, die für Außenstehende nicht sofort erkennbar sind. Dokumentiere diese "ungeschriebenen Regeln", denn sie enthalten wertvolles Wissen über die Praxiskultur.
Die detaillierte Analyse der Arbeitsabläufe zeigt dir, wo Zeit verloren geht oder Ressourcen ineffizient genutzt werden. Verfolge den Weg eines Patienten von der Anmeldung bis zur Verabschiedung. Wie lange sind die Wartezeiten? Wo entstehen Engpässe? Besonders aufschlussreich ist ein Blick auf die Sprechstundenorganisation und die Koordination zwischen Empfang, Assistenz und Behandlungsräumen.
Das Optimierungspotenzial liegt oft in Details: Vielleicht sind die Wege im Praxisgrundriss zu lang, die EDV veraltet oder die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden umständlich. Befrage dazu auch das Team – es kennt die Schwachstellen meist am besten und hat oft praktikable Lösungsideen. Prüfe auch, ob die bisherigen Sprechzeiten dem Patientenbedarf entsprechen oder ob eine Anpassung sinnvoll wäre.
Bei der Implementierung neuer Strukturen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Verändere nicht alles auf einmal – das verunsichert sowohl Personal als auch Patienten. Entwickle stattdessen einen Stufenplan für Veränderungen. Beginne mit offensichtlichen Verbesserungen, die für alle spürbare Vorteile bringen. Kommuniziere klar, warum du welche Änderungen vornimmst und beziehe das Team in den Prozess ein. Eine gemeinsame Workshop-Reihe zur Neugestaltung der Praxisabläufe kann Widerstände abbauen und die Identifikation mit den neuen Strukturen fördern.
Personalübernahme und Teambuilding

Rechtliche Grundlagen der Personalübernahme
Die Übernahme des Praxisteams folgt klaren arbeitsrechtlichen Vorgaben nach § 613a BGB. Bestehende Arbeitsverhältnisse gehen automatisch mit allen Rechten und Pflichten auf dich als neuen Praxisinhaber über. Dies bedeutet, dass du die bisherigen Arbeitsverträge unverändert fortführen musst – inklusive vereinbarter Vergütung, Urlaubsansprüchen und Arbeitszeiten. Eine Kündigung wegen der Praxisübernahme ist rechtlich unzulässig.
Die Mitarbeitenden haben allerdings ein Widerspruchsrecht gegen den Übergang ihres Arbeitsverhältnisses, das sie innerhalb eines Monats nach ordnungsgemäßer Information ausüben können. Informiere daher alle Teammitglieder schriftlich und detailliert über die geplante Übernahme, den Zeitpunkt und die Gründe sowie über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen.
Für eine reibungslose Übergangsphase empfiehlt sich eine Klausel im Praxisübernahmevertrag, die den bisherigen Inhaber verpflichtet, bei Personalfragen unterstützend zur Verfügung zu stehen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn es um historisch gewachsene Gehaltsstrukturen oder individuelle Vereinbarungen geht.
Das neue Team formen
Die ersten Wochen mit dem übernommenen Team sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Gestalte die Kennenlernphase bewusst – nimm dir Zeit für persönliche Gespräche mit jedem Teammitglied. Frage nach beruflichen Stärken, Entwicklungswünschen und nach dem, was ihnen an der bisherigen Praxiskultur wichtig war.
Kommuniziere deine Vision für die Praxis klar und inspirierend. Welche Werte sollen die Arbeit prägen? Welche Ziele verfolgst du? Sei dabei authentisch und zeige, dass du das bestehende Team schätzt. Suche die Balance zwischen Kontinuität und notwendigen Veränderungen.
Ein gemeinsamer Workshop zur Neuausrichtung kann Wunder wirken. Hier lassen sich Rollen klären, Prozesse optimieren und ein gemeinsames Leitbild entwickeln. Externe Moderation kann dabei helfen, alle Stimmen gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen und auch schwierige Themen konstruktiv zu bearbeiten.
Widerstände gegen Veränderungen sind normal und kein Grund zur Sorge. Sie zeigen oft, dass Mitarbeitende emotional an ihrer Arbeit beteiligt sind. Höre aktiv zu, wenn Bedenken geäußert werden. Nimm konstruktive Kritik ernst und erkläre deine Entscheidungen nachvollziehbar. Manchmal ist ein schrittweises Vorgehen sinnvoller als radikale Änderungen.
Materielle und immaterielle Anreize, wie flexible Arbeitszeiten oder die Übernahme besonderer Verantwortungsbereiche, steigern die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen langjährige Mitarbeitende, die oft eine starke Bindung zum Vorgänger aufgebaut haben. Respektiere ihre Erfahrung und ihr Wissen, ohne dich davon einschränken zu lassen. Gleichzeitig solltest du von Anfang an deine Rolle als neue Führungsperson etablieren und einen eigenen Führungsstil entwickeln, der zu dir und deinen Werten passt.
Patientenübernahme und -kommunikation
Die ersten Patientenkontakte
Der erste Eindruck zählt – besonders bei der Übernahme eines bestehenden Patientenstamms. Die Art, wie du dich bei den Patienten einführst, beeinflusst maßgeblich ihre Entscheidung, ob sie in der Praxis bleiben oder wechseln werden. Idealerweise stellt der Vorgänger dich persönlich vor, etwa durch gemeinsame Sprechstunden in der Übergangsphase. Dies signalisiert Vertrauen und erleichtert den Patienten den Wechsel.
Nutze die ersten Begegnungen, um eine persönliche Beziehung aufzubauen. Nimm dir etwas mehr Zeit für diese Termine als üblich. Zeige echtes Interesse an der Krankengeschichte und den Bedürfnissen deiner neuen Patienten. Viele werden verständlicherweise verunsichert sein und Vergleiche ziehen. Eine empathische, zugewandte Haltung hilft ihnen, Vertrauen zu fassen.
Denke daran: Jeder Patient bringt eine individuelle Geschichte mit. Manche wurden jahrelang vom Vorgänger betreut und müssen nun eine neue Vertrauensbasis aufbauen. Respektiere diese Bindung, ohne dich dadurch unter Druck setzen zu lassen, identisch zu arbeiten wie dein Vorgänger.
Kommunikationsstrategien
Ein durchdachter Ankündigungsbrief sollte etwa vier bis sechs Wochen vor der Übergabe an alle Patienten versandt werden. Darin stellst du dich kurz vor, erklärst deinen beruflichen Hintergrund und deine Motivation. Betone die Kontinuität in der Versorgung, aber auch deine eigenen Schwerpunkte und eventuell neue Angebote. Ein gemeinsam unterzeichneter Brief von dir und dem Vorgänger schafft zusätzliches Vertrauen.
In den Patientengesprächen triffst du auf unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse. Manche Patienten werden neugierig und offen sein, andere skeptisch oder sogar ablehnend. Höre aktiv zu und gehe auf Fragen ein. Erkläre Unterschiede in deinem Behandlungsansatz, ohne den Vorgänger zu kritisieren.
Bereite dich auf kritische Fragen vor. Typisch sind Bedenken wie "Wird sich an den Sprechzeiten etwas ändern?" oder "Bleibt meine Behandlung gleich?". Antworte ehrlich, aber konstruktiv. Wenn du tatsächlich Änderungen planst, erkläre die Vorteile für die Patienten. Wird ein Patient besonders emotional, biete ein separates Gespräch an, um seine Bedenken in Ruhe zu besprechen.
Denke daran: Auch wenn nicht alle Patienten bleiben werden – was normal ist – bildet die transparente Kommunikation die Grundlage für langfristig stabile Arzt-Patienten-Beziehungen. Eine offene Haltung gegenüber Feedback in der Anfangsphase kann zudem wertvolle Hinweise liefern, was den Patienten besonders wichtig ist.
Praxismarketing aktualisieren
Die neue Praxisidentität gestalten
Die Übernahme einer Praxis bietet die einmalige Chance, deinen eigenen Praxisstil zu etablieren. Überprüfe das bestehende Corporate Design kritisch: Spiegelt es deine Werte und deinen medizinischen Ansatz wider? Ein behutsames Redesign kann Kontinuität wahren und gleichzeitig Modernität signalisieren. Achte auf einen roten Faden bei Praxisschild, Briefpapier, Visitenkarten, Terminzetteln und Praxiskleidung. Professionelle Grafikdesigner mit Erfahrung im Gesundheitsbereich können hier wertvolle Unterstützung leisten.
Die Formulierung einer klaren Praxisphilosophie ist fundamentaler als viele Ärzte zunächst annehmen. Sie definiert nicht nur dein Selbstverständnis, sondern prägt auch die Erwartungshaltung deiner Patienten und die Arbeitskultur deines Teams. Frage dich: Wofür stehst du als Arzt? Welche Werte sind dir in der Patientenbetreuung besonders wichtig? Was unterscheidet deine Praxis von anderen? Eine authentische, gut kommunizierte Philosophie schafft Identifikation – sowohl nach innen als auch nach außen.
Marketingkanäle aktivieren
Die Praxis-Webseite ist heute das digitale Aushängeschild schlechthin. Modernisiere sie zeitnah, aber informiere vorher bestehende Patienten über die Änderungen. Eine zeitgemäße Website sollte responsive sein, also auf allen Endgeräten gut funktionieren, und wesentliche Informationen wie Sprechzeiten, Leistungsspektrum und Notfallhinweise leicht auffindbar präsentieren. Authentische Fotos von dir und deinem Team schaffen Vertrauen vor dem ersten persönlichen Kontakt.
Social Media Marketing eignet sich vor allem dann, wenn du viele Privatleistungen anbietest.
Nutze die lokalen Netzwerke gezielt für deinen Einstieg. Stelle dich persönlich bei überweisenden Kollegen vor und nimm Kontakt zu relevanten Gesundheitseinrichtungen in der Umgebung auf. Der Beitritt zu lokalen Ärztenetzen, Qualitätszirkeln oder Berufsverbänden öffnet Türen und erleichtert den fachlichen Austausch. Auch Apotheken, Sanitätshäuser und therapeutische Einrichtungen sind wichtige Ansprechpartner.
Gezielter Pressearbeit kommt bei der Praxisübernahme besondere Bedeutung zu. Eine Pressemitteilung an lokale Medien und Fachpublikationen mit Information zur Übernahme erreicht potenzielle Patienten auf breiter Ebene. Ein Tag der offenen Tür kann zusätzliche Aufmerksamkeit generieren. Dabei solltest du die berufsrechtlichen Vorgaben zur ärztlichen Werbung beachten, die in den Berufsordnungen der Landesärztekammern geregelt sind und in den letzten Jahren deutlich liberalisiert wurden, aber nach wie vor bestimmte Grenzen setzen.
Digitalisierung und technische Systeme

IT-Infrastruktur bewerten
Die technischen Systeme einer Praxis sind heute ihr digitales Rückgrat. Bei der Übernahme stehst du vor der grundlegenden Entscheidung, ob du die bestehende Praxissoftware weiterverwenden oder auf ein neues System umsteigen solltest. Beide Wege haben ihre Berechtigung: Die Beibehaltung der Software sichert Kontinuität für das Team und vermeidet Einarbeitungszeiten. Ein Wechsel hingegen bietet die Chance, mit einem moderneren, besser zu deinen Arbeitsabläufen passenden System durchzustarten.
Wichtige Entscheidungskriterien sind das Alter der aktuellen Software, die Zufriedenheit des Teams damit und die Zukunftsfähigkeit des Systems. Prüfe, ob Updates regelmäßig eingespielt wurden, ob die Software mit aktuellen Sicherheitsstandards kompatibel ist und ob sie die kommenden Anforderungen an die Telematikinfrastruktur erfüllen kann. Beziehe unbedingt dein Praxisteam in diese Entscheidung ein – sie arbeiten täglich mit dem System.
Ein Hardware-Update ist oft unumgänglich, selbst wenn die Software beibehalten wird. Computer, die älter als fünf Jahre sind, sollten in der Regel ausgetauscht werden. Achte auf ausreichende Rechenleistung, moderne Bildschirme mit Blickschutzfilter und eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur. Vergiss nicht den Datenschutz: Verschlüsselte Festplatten, ein aktuelles Rechte- und Rollenkonzept sowie eine professionelle Firewall sind keine Kür, sondern Pflicht.
Digitale Prozessoptimierung
Eine Online-Terminvergabe ist heute kein Luxus mehr, sondern wird von vielen Patienten als Standardservice erwartet. Sie entlastet zudem das Praxisteam erheblich, da telefonische Terminvereinbarungen zeitaufwändig sind. Moderne Systeme bieten zusätzlich Features wie automatische Terminerinnerungen per SMS oder E-Mail, was die No-Show-Rate deutlich senken kann.
Die digitale Patientenakte bietet enormes Potenzial für Effizienzsteigerungen. Mit einer strukturierten Dokumentation findest du schneller relevante Informationen und kannst häufig verwendete Textbausteine hinterlegen. Die Herausforderung liegt in der Integration aller Informationsquellen – von Laborbefunden über Arztbriefe bis hin zu Bilddaten. Nutze die Praxisübernahme, um bestehende Daten zu konsolidieren und eine einheitliche Dokumentationsstruktur zu etablieren.
Telemedizinische Angebote haben seit der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die Integration von Videosprechstunden kann deine Praxis für bestimmte Patientengruppen attraktiver machen und eignet sich besonders für Verlaufskontrollen, einfache Beratungsgespräche oder die Besprechung von Befunden. Kläre vorab die technischen und abrechnungstechnischen Voraussetzungen und schulde dein Team im Umgang mit den neuen Kommunikationskanälen.
Bei allen digitalen Neuerungen gilt: Implementiere sie schrittweise und stelle sicher, dass dein Team die Systeme kompetent bedienen kann. Die beste Technik nützt nichts, wenn sie im Praxisalltag nicht reibungslos funktioniert oder vom Team nicht akzeptiert wird.
Bei der Praxisoptimierung kannst du auch Lean Management Prinzipien einsetzen, mehr dazu in diesem Blogartikel.
Abrechnungsoptimierung
Die Abrechnung ist das finanzielle Fundament deiner Praxis und verdient besondere Aufmerksamkeit. Eine systematische Analyse der bestehenden Abrechnungspraxis sollte zu deinen ersten Aufgaben gehören. Prüfe konkret, ob alle erbrachten Leistungen tatsächlich abgerechnet werden und ob die Dokumentation den Anforderungen der Kostenträger entspricht. Häufig entdeckst du dabei Leistungen, die zwar erbracht, aber nicht oder nicht vollständig abgerechnet wurden – ein klassisches Symptom fehlender Abrechnungsroutinen oder unzureichender Kenntnisse der Gebührenordnungen.
Bei der Identifikation von Optimierungspotenzial hilft ein strukturierter Ansatz. Vergleiche deine Abrechnungsdaten mit Fachgruppendurchschnitten, die von der KV bereitgestellt werden. Analysiere die Top-20-Ziffern und überprüfe, ob die Verteilung plausibel ist. Achte auch auf die Relation zwischen diagnostischen und therapeutischen Leistungen sowie auf die Nutzung von Gesprächsziffern. Ein erfahrener Praxisberater oder spezialisierter Steuerberater kann dir dabei wertvolle Unterstützung bieten und typische Abrechnungsfehler identifizieren.
Die Implementierung effizienterer Abrechnungssysteme beginnt mit der technischen Infrastruktur. Moderne Praxissoftware bietet intelligente Plausibilitätschecks, die unzulässige Ziffernkombinationen oder Abrechnungsausschlüsse automatisch erkennen. Ebenso wichtig sind klare Prozesse: Wer dokumentiert welche Leistungen wann und wo? Wie werden Privatleistungen erfasst? Wie erfolgt die Kontrolle vor dem Quartalsabschluss? Ein durchdachter Workflow minimiert das Risiko von Abrechnungsverlusten erheblich.
Die Schulung deines Teams ist ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor. Selbst erfahrene MFAs benötigen regelmäßige Updates zu Abrechnungsänderungen und fachspezifischen Besonderheiten. Investiere in qualifizierte Fortbildungen und schaffe eine Atmosphäre, in der Abrechnungsfragen offen diskutiert werden können. Besonders wertvoll sind interne Besprechungen zu häufigen oder komplexen Abrechnungsfällen. Teile dein Wissen und erkläre dem Team den medizinischen Hintergrund bestimmter Ziffern – dies fördert das Verständnis und erhöht die Motivation zur korrekten Abrechnung.
Denke immer daran: Optimale Abrechnung bedeutet nicht Maximalabrechnung, sondern rechtssichere Vergütung aller tatsächlich erbrachten Leistungen. Eine professionelle Abrechnungspraxis schützt dich vor Regressen und sichert gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität deiner Praxis.
Mehr zum Thema Praxisoptimierung findest du auch in unserem Ratgeber.
Fazit
Die Übernahme einer Praxis ist ein komplexer, aber lohnender Weg in die ärztliche Selbstständigkeit. Mit den vorgestellten zehn Schritten hast du einen strukturierten Fahrplan für dieses herausfordernde Projekt. Von der sorgfältigen Auswahl der richtigen Praxis über die solide Finanzierung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung deiner Abläufe – jede Phase erfordert Aufmerksamkeit und strategisches Denken.
Besonders entscheidend für den Erfolg ist die Balance zwischen Bewahren und Erneuern. Nicht alles muss anders werden, aber nichts sollte unreflektiert bleiben. Die größte Herausforderung liegt oft in der Führung des Teams und der behutsamen Einführung von Veränderungen.
Der Weg in die eigene Praxis ist anspruchsvoll, aber er bietet dir auch einzigartige Chancen zur beruflichen Selbstverwirklichung und persönlichen Weiterentwicklung. Die Freiheit, Medizin nach deinen eigenen Vorstellungen zu praktizieren und eine individuelle Praxiskultur zu schaffen, ist durch nichts zu ersetzen.
Unterstützung findest du bei Beratern der Kassenärztlichen Vereinigungen, Ärztekammern und spezialisierten Praxisberatern. Auch der Austausch mit Kollegen in ähnlicher Situation kann überaus wertvoll sein.
Der Erfolg deiner Praxisübernahme liegt in deinen Händen – mit der nötigen Vorbereitung, einem klaren Konzept und dem Mut zur eigenen Vision wird dieser Schritt zum Startpunkt einer erfüllenden beruflichen Zukunft.
Neueste Artikel
Newsletter und kostenloses E-Book